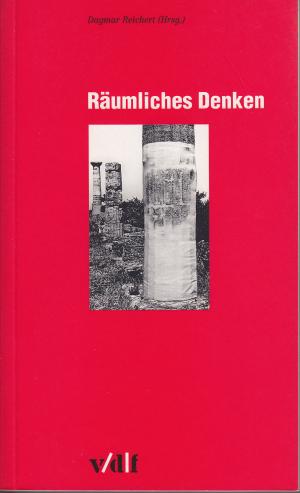Das Gute im Whua ist, dass es hier überall Uhren hat.
Habe trotzdem den Zug verpasst.
Heute war die erste orangene Holzperle meiner Kette an der Reihe, was bedeutet: Ich mache eine „Performance“.
Es ist so ein Tag, an dem es nie richtig hell werden will. Ich lag bis 8 Uhr 35 im Bett.
Im Bett suchte ich nach einer Idee für meine Performance. Ob ich wohl etwas inspirierendes träumen würde? Ich habe von Gletschern geträumt und einem Mord in den Felsen. Eine Verarbeitung des Geographielernens mit meiner Tochter und der letzten Netflix-Serie, die ich mir angeschaut hatte.
Ich stand auf. Im Zug nach Luzern überlegte ich mir, ob ich vielleicht zu einem Gletscher fahren sollte, aber es regnete schon seit Stunden.
Im Whua bastelte ich mir einen Regenschutz aus einem Duschvorhang.
Ich packte Videokamera, Stativ, Wassermalkasten und Pinsel ein.
Auf dem Vorplatz zum Bahnhof begann ich, den regennassen Boden zu bepinseln.
Eine Dame kam vorbei und meinte, dass das doch alles gleich wieder weggespült würde, worauf ich entgegnete, dass so immer wieder etwas Neues entstehen könne.
Später kam eine Herr vorbei und fragte: „Was gibt denn das?“
„Vielleicht einen Regenbogen?“ entgegnete ich.
Die Farben verschwammen so schön auf dem nassen Boden, und was ich malte löste sich fortwährend auf. Ich war nass, es fühlte sich an wie im Schwimmbad.
Wenn ich schneller malte, war mehr Farbe zu sehen, für eine kurze Zeit.
Ich hatte mich mit dem Regen angefreundet, legte mich auf den Boden und liess mich duschen.
Wie lange bleibt die Kunst, die ich mache in dieser Welt bestehen? Ist es das Bild, das bleibt? Ist es die Handlung, die Veränderung, welche die Handlung in mir selbst bewirkt hat, die Erinnerung an die Handlung? Was ist sichtbar? Ist es wichtig, das etwas bleibt? Will ich die Welt verändern, will ich sie gestalten? Welche Welt? Die innere oder die äussere, oder ist beides dasselbe?
Regen ist ein Symbol für das Fliessen, Reinigen und auch Tränken.
Als Kind liebte ich den Regen, im Sommer, um nackt darunter zu tanzen.
Heute mag ich ihn manchmal nicht mehr so sehr. Ich versuche mich davor zu schützen.
Der Schutz, mein Regenmantel, wird während der Aktion immer durchnässter, verliert seine Bedeutung des Schutzes und wird zum Kleid. Gleichzeitig schwindet auch mein Widerstand. Der Regen wird zum Kleid. Nass bis auf die Haut lege ich mich darunter, lasse mich waschen, tränken…
Ich male ein Bild mit der Zeit, die vergeht, wie mein Bild. Was bleibt: ein Film, durchgepauste Zeit.
Ich lese:
Straumann (1996): Norbert Straumann, Raum, Zeit und deren geometro-dynamische Verschmelzung, in: Räumliches Denken, hrsg. von Dagmar Reichert, Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.
Der Text behandelt ein Phänomen, das mich seit längerem beschäftigt. Genaugenommen seit meiner Zeit am Gymnasium. Was hat es mir der Lichtgeschwindigkeit auf sich und wie hängt die Zeit mit ihr zusammen? Ich hatte irgendwo gehört, oder gelesen, dass man, wenn man schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reist, durch die Zeit reisen könne. Was mir merkwürdig erschien, so braucht man doch immer noch diese eine Sekunde, um diese 299’792’458 m zurückzulegen. Das kann also nicht wirklich dabei helfen, die Zeit rückwärts zu drehen. Man müsste dabei ja angekommen sein, bevor man losgefahren ist.
Ich sitze übrigens gerade im Whua auf dem Sofa. Hier scheint die Zeit stehen zu bleiben, trotz all der Uhren.
Meine Logik beruht natürlich auf dem Prinzip der Gleichzeitigkeit, welches, wie ich dem Text entnehmen konnte, heute mehr als in Frage gestellt wird. Zeit und Ort sind unlösbar miteinander verknüpft. Eigentlich gibt es immer nur das Hier und Jetzt. Und trotzdem interagieren wir täglich mit Menschen und Gegenständen, welche sich in einem anderen Hier und Jetzt befinden. Wir befinden uns also nicht nur nicht am selben Ort, sondern auch nicht in der selben Zeit und können trotzdem (oder vielleicht gerade deshalb?) kommunizieren.
Dieser Umstand wurde früher sehr deutlich bei Ferngesprächen. Die Worte des Telefonierenden brauchten manchmal mehrere Sekunden um am anderen Ende der Leitung anzukommen. Die Kommunikation war erschwert, verzögert. Das Telefonat dauerte dadurch länger, als das gleiche Gespräch gedauert hätte, wäre es von zwei sich gegenübersitzenden Personen geführt worden. Mit der digitalen Telefonie sind diese Pausen meist etwas kürzer geworden, dafür fand ich mich vor kurzem in einer Zeitschlaufe gefangen, als ich von der Schweiz aus mit einer Freundin in Senegal telefonierte. Es begann damit, dass ich mich wunderte, weshalb sie das selbe nochmals sagte und dann ein zweites Mal zur Toilette ging und das Telefon ihrem Mann übergab, welcher mich fragte, wie es mir denn geht. Als das Ganze zum dritten Mal passierte, fühlte ich mich etwas verwirrt. Ob das nun ein Trick der Telefongesellschaft war, um an teuren Gebühren Geld zu verdienen, oder einfach ein Fehler im System weiss ich nicht. Im ersten Moment überkam mich wohl dasselbe metaphysische Gruseln, welches Mani Matter im Coiffeursalon überkommt, als er seine unendlichen Spiegelbilder entdeckt.
In der digitalen Welt ist die Zeit eine andere, falls sie dort überhaupt existiert. Code, der wenig Raum und Zeit benötigt, um ausgeführt zu werden, und sich unendlichfach wiederholen und kopieren lässt. Sitze ich vor dem Computer, vergesse ich die Zeit. Backe ich Brot im Backhofen auf, verbrennt es – lasse ich ein Bad ein, läuft es über. Hat das damit zu tun, dass ich mich dabei (fast) nicht bewege? Der Raum verschwindet, ich bewege mich in Gedankenräumen, virtuellen Dimensionen. Die Maschine leiht sich mein Gehirn.
Ich stehe auf der Plakatsäule und drehe ich im Kreis. Vor dem Bahnhof Stansstad, vor dem Whua. Alle 360 Grad sehe ich die Bahnhofsuhr. Wie ihr Sekundenzeiger drehe ich mich im Uhrzeigersinn. Was mach ich hier oben? „Ich hab’ dir doch gesagt, die spinnen in Stansstad!“ Spinne ich? Vielleicht ein bisschen? Ich tanze bewusst aus dem Kreis, um dem Strom zu entkommen. Erweitere mein Bewegungsrepertoire. Zum Glück gibt es die Kunst. Diesen Sammelbegriff, der für alles Platz hat, was sonst in keine Schublade passt. Nein, ich spinne nicht, ich mache bloss Kunst.
Kudi kommt vorbei und rettet mich, indem er fragt, ob ich eine Verkehrspolizistin bin. Ich sage stolz: „Ja.“
Ich habe jetzt eine Aufgabe. Ich regle den Verkehr, ich dirigiere die Bewegungen, die sowieso schon passieren. Ich habe die Macht, denn ich stehe über den Dingen.
Es wird dunkler, die Bewegungsrichtung hat sich geändert. Ich drehe nun gegen den Urzeigersinn. Es ist kalt. Wie lange noch – werde ich drehen?
Ich glaube, jetzt ist genug. Ich versuche hinunterzuklettern, doch die Plattform ist nass und meine Hände steif. Vielleicht rutsche ich aus und falle? Ich ziehe mich wieder hoch. Ein Herr fragt, ob er mir helfen kann, ich solle mich runterlassen, er würde mich halten. Ich spinne aber schon ein bisschen, meint er. Auch Felix ist da. Ich möchte mich nicht von dem älteren Herrn halten lassen, habe Angst, ihn zu verletzen. Er fragt, ob er die Feuerwehr holen soll. Ich frage, ob sie vielleicht Urs im Whua holen können.
Urs kommt mit den Sockeln. Über die Sockel klettere ich hinab auf die Strasse.
Zur sanften Einkaufspassagenmusik tanze ich auf der Bank vor der Spitzenwäsche. Die Musik lenkt meine Bewegung. Sie ist leise. Ich schliesse meine Augen, um sie besser zu hören. Die Passanten tragen Gepäck, welches sie schnell wohin bringen.
Intimität?
Ausgestellt im Schaufenster zwischen rosa Herzen?
Intim bin ich verbunden mit der Musik. Meine Hände zittern leicht.
Innen? Aussen?
Guten Tag, was machen Sie hier?
Kunst.
Würde es Ihnen etwas ausmachen, das ausserhalb des Bahnhofes zu machen?
Ist das nicht öffentlicher Raum?
—
Ich mache eben Kunst im öffentlichen Raum
Würde es ihnen etwas ausmachen, das nächste Mal dafür eine Bewilligung einzuholen, bei der SBB? Die Leute schauen eben recht komisch, wenn da einfach jemand die Kamera aufstellt und filmt.
Heisst das, ich soll aufhören?
Ja.
OK.
Ich lese:
Arenth (1967): Hannah Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben, Kapitel 7, 8, 9, Piper Verlag GmBH, München/Berlin 1967.
„Denn bezaubernd gerade kann das Öffentliche, das sich der Grösse eignet, niemals sein, und zwar eben darum, weil es für das irrelevante keinen Platz hat“ S.65
Wo ist die Relevanz in meiner Arbeit?
Es ist eine sehr persönliche Arbeit und sie befasst sich mit dem Privaten, Intimen. Relevanz ergibt sich durch einen Zweck. Weshalb tue ich das, was ich tue?
Ich will diese Grenze erforschen, vielleicht. Ich befinde mich in der Massengesellschaft, in der gleichsam alles irrelevant zu werden scheint. Viele Menschen gemeinsam in einem Raum, jeder für sich allein. Es ist mir oft unerträglich, mich, morgens im Zug, zwischen diese vielen Menschen zu quetschen. Habe ich einen Fensterplatz, gibt es wenigstens noch dieses kleine Tischchen, dass mich von meinem Gegenüber trennt und mich zugleich mit ihm verbindet – sitze ich am Gangplatz, bleibt mir nur noch die Möglichkeit, die Augen zu schliessen und mich in mein Inneres, meine Intimität zu flüchten, um dieser unmöglichen Situation auszuweichen. Die räumliche Nähe und die mentale Distanz ergeben dieses merkwürdige Paradox, dieses Verschwinden einer gemeinsamen Welt, welches Hannah Arendt unter anderem mit dem Gleichnis, eines Tisches, der bei einer Séance plötzlich verschwindet beschreibt….
Rückzug.
Manchmal möchte ich mich einfach nur verkriechen. Ich habe mir ein Zelt dafür gebaut. Von da aus präsentiere ich meine Arbeit. Das Zelt ist gefüllt mit Kissen, mit vielen Kissen. Überfüllt. Ich muss da mal Platz machen. Ich werfe die Kunst in den halböffentlichen Raum des menschenleeren WHUA.
Manchmal ist es anstrengend alles immer alleine zu machen.
Gestern ist meine Kette geplatzt. Die farbigen Holzperlen kullerten auf den Küchenboden.
Der Plan ist durcheinandergeraten. Ich könnte die Kette wieder zusammensetzen. Ich könnte aber auch ein Holzperlenspiel daraus basteln.
Was will ich? Vielleicht könnte ich die anderen bitten, mir einen neuen Plan zusammenzustellen?
Soll ich es dem Zufall überlassen? Das Ganze? Relevanz?
Selbstdarstellung! Wie kann ich nur von dieser ewigen Selbstdarstellung wegkommen? Stelle ich mich selbst dar?
Stelle ich einen inneren Konflikt dar, den wir vielleicht alle in uns tragen?
Wie steht’s mit äusseren Konflikten?
Brauche ich Konflikte? Führe ich sie herbei? Oder möchte ich sie sichtbar machen?
Warum ich Kunst mache, weiss ich nicht. Ist irgendwie so ein Bedürfnis, den fixen Strukturen des Alltags zu entfliehen, oder sie aufzulösen, ein Versuch vielleicht, zu beweisen, dass es auch anders geht. Dabei mache ich mir meine eigenen fixen Strukturen, weil ich anscheinend ohne nicht kann, aus Angst, mich zu verlieren. Was mach‘ ich nun mit der Kette?
Hauptsache, ich mache?
Ich lese:
Literatur:
Marchart (2005): Oliver Marchart, „There is a crack in evereything…“ Public Art als politische Praxis, Text basiert auf einem Vortrag an der Tagung Kunst Öffentlichkeit Zürich in der Kunsthalle Zürich, 17./18. November 2005.
Welche Art von Öffentlichkeit stellen fiktionale Menschentrauben in der Nidwaldnerzeitung dar?
Marchart schreibt: „Wo Konflikt, oder genauer Antagonismus ist, dort ist Öffentlichkeit, und wo er verschwindet, verschwindet Öffentlichkeit mit ihm….Öffentlichkeit ist nichts anderes als der Aufprall selbst“
Gibt es also in einer friedlichen Welt keine Öffentlichkeit mehr?
Kann dieser Aufprall auch eine Explosion von Kreativität sein, ein gemeinsames Verhandeln, eine konstruktive Zusammenarbeit ohne gemeinsamen Feind?
Kann eine friedliche Welt existieren? Ist ein Leben ohne Schwierigkeiten lebenswert?
Ich wünsche mir Frieden, deshalb muss es mir auch möglich sein, mir eine friedliche Welt zu denken. Klar ist es langweilig, wenn alle gleicher Meinung sind, aber man kann ja auch über verschiedene Meinungen diskutieren ohne zu streiten.
„You may say I’m a dreamer” (John Lennon, Imagine, 1971)
Ich denke, um einen Sinn im Leben zu sehen braucht man irgendein Ziel; dieses Ziel könnte ein positives sein. Um ein Ziel zu erreichen, muss man aber meistens Probleme lösen. Ist somit ein Ziel zu finden automatisch mit der Erstellung eines Problems verbunden?
Kann das Leben aber vielleicht auch schön sein, ohne Ziel und Sinn, indem man einfach im Moment lebt und spielt? Doch auch Kinderspiele stellen eigentlich nichts anderes als Probleme dar. Unsere ganze Existenz beruht auf Problemen. Wie schaffen wir es genug Nahrung zu uns zu nehmen, damit wir weiterleben? Wie finde ich jemanden, mit dem ich mich fortpflanzen kann, oder einfach nur mein angeborenes Bedürfnis nach körperlicher Nähe zu stillen? Was macht die Menschheit, wenn die Erde einmal unbewohnbar sein wird? Werden wir überhaupt so lange leben?
Unsere begrenzte Lebensdauer, der begrenzte Platz auf der Erde,…
Eigentlich hätten wir genug Probleme zu lösen, damit uns nicht langweilig würde, ohne noch so massenweise welche zu erfinden, wie wir es tun. Manchmal glaube ich, wir erstelllen lieber Probleme, als welche zu lösen, vielleicht auch, um uns vor grossen, scheinbar unlösbaren Problemen abzulenken. Sind wir Problem-Messies?
Der grosse Grundkonflikt der über unserem Leben schwebt – wir wollen Leben, müssen aber irgendwann sterben – zerreisst uns fast.
Kann sein, dass ich mir in dem, was ich schreibe, selbst widerspreche, aber ich habe nunmal keinen fixen Standpunkt, auch keine Position. Meine Gedanken gleiten. Ich kenne die Lösung für das Grundproblem nicht. Dennoch gibt es viele Probleme auf dieser Welt, die ich gerne lösen würde, und nicht wenige davon habe ich selbst geschaffen.
Kann nicht auch eine Versöhnung politisch sein?
„But I’m not the only one“(ebd.)
-Darf ich sich bitten, diesen Platz zu verlassen? Das ist Privatgrund.
-Aber da kann man ja auch durchlaufen.
-Es ist Privatgrund
-Ich habe aber auch Leute gesehen, die hier durchlaufen.
-Das wird geduldet, aber es ist Privatgrund.
-Und warum wird es nicht geduldet, dass ich hier sitze?
-Weil die Besitzerin das nicht will.
-Ah, und sie wurden geschickt…
-Ja, ich bin der Überbringer der Botschaft.
-Sie können ja dort drüben weitermachen, das ist öffentlich.
-OK, dann gehe ich woanders hin
-….
-Was machen sie da eigentlich?
-Ich setze die Fahnen neu zusammen, weil sie so ein bisschen langweilig sind.
-Ich meine, was bezwecken Sie mit dem?
-Ich versuche herauszufinden, ob Öffentlichkeit auch ohne Antagonismus entstehen kann.
-Aber was bezwecken sie damit?
-Ich untersuche etwas.
-Also ich denke, sie spinnen! Sie sitzen hier in der Kälte…
-Mir ist nicht kalt!
-Doch es ist viel zu kalt, hier auf dem Boden…
Ich zeige ihm die doppelt gefaltete Wolldecke unter dem weissen Satintuch
-Das reicht nicht!
-Möchten Sie ein Fähnchen?
-Was mach ich damit?
-Sie können es irgendwo anmachen.
-Das tu‘ ich gleich auf meinen Balkon.
Heute wieder performen!
Ich war aber gar nicht in der Stimmung. Zuerst. Diese ständigen Antagonismen. Man mag nicht immer kämpfen. Ausserdem fühlte ich mich auch nicht so wahnsinnig fit.
Sich stets neu erfinden ist anstrengend.
Ich habe da noch dieses alte Polizeiabsperrband, welches ich mal in Zürich am Ufer der Sihl gefunden habe, beim Plastik sammeln. Es war ein wenig schmutzig und ich wollte es schon lange mal waschen. Irgendetwas waschen, das passt zu Stansstad, wo sogar der saubere Boden gewischt wird. Stansstad ist seeehhr sauber. Das Geld, das hier liegt, vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht könnte ich Bankomaten waschen gehen? Ich machte einen Spaziergang, den Bankomaten entlang: Einmal Postomat, einmal Raiffeisen und einmal Nidwaldner Kantonalbank. Nur der Postomat war von aussen frei zugänglich, die beiden anderen befanden sich im Inneraum. Auf soviel Konfrontation hatte ich heute wirklich keine Lust. Ich suchte nach einem Polizeiposten, dachte, ich könnte vielleicht davor das Absperrband waschen – es gibt keinen Polizeiposten in Stansstad. Nach einem Spaziergang, dem Seeufer entlang, legte ich mich in die Sonne. Danach machte ich mich auf den Rückweg ins WHUA.
Ich koche Grüntee mit Pfefferminze, wie ich ihn aus Senegal kenne und setze mich mit drei Gläsern und ein paar Keksen an die Sonne vor dem WHUA.
Ein Herr geht vorbei: „O sole mio?“
Gestärkt durch den Zuckerschub, spaziere ich ein zweites Mal Richtung See.
Ich hole Wasser aus dem See und wasche damit das Band. Dann beginne ich daraus ein Netzt zu spinnen. Auf dem Steg, nicht auf der Brücke. Ein Mädchen bleibt stehen und schaut. Danach setzt sie sich mit ihrem Vater auf eine Parkbank – hin und wieder höre ich ein Lachen.
Ich sehe gequält aus, wie ich mich durch das Band webe. Und doch scheine ich durch eine seltsame Motivation getrieben. das Band beschränkt meine Bewegungen, schenkt mir gleichzeitig neue. Ich teste seine Elastizität, die Elastizität der Grenze. Ich zerreisse sie durch meine Bewegung – wenn nötig.
Das Band ist zwischen zwei Absperrungen aufgespannt. Sie trennen mich vom Wasser. Schützen mich? Das Wasser ist zu kalt – um hinein zu springen.
Wer ist hier die Polizei?
Ich lese:
Literatur:
Torrens (2014): Valentín Torrens, Performance as play, in: HOW WE TEACH PERFORMANCE ART, Valentín Torrens Edition, Outskirts Press inc., USA 2014

Torrens vergleicht das Raummuster, das die Performance im Kunstfeld einnimmt, mit dem Muster in welchem das Hirn funktioniert, während des kreativen Prozesses, oder wenn wir spielen.
Das was passiert, passiert nicht an einem bestimmten Ort, sondern zwischen Orten („to be in between“), im Zwischenraum, der durch seine Undefiniertheit, das Entstehen von Neuem ermöglicht. Torrens spricht auch von einer Metasprache, welche das Spiel ausmacht.
Dabei bezieht er sich auch auf Victor Turner* und seine Theorie der „liminality“, wobei Turner einen Schwellenzustand beschreibt, in dem alte Regeln nicht mehr gelten und neue noch nicht hergestellt wurden. *(Turner (1987): Victor Turner, The Anthropology of Performance, PAJ Publications, New York, 1987.)
Man spielt freiwillig, meint Torrens, aus Freude am Spiel selbst, nicht zweckorientiert; Zeit und Raum verändern sich zu einer Art „space vertige“ (Raumschwindel?)
Sich auf Mihaly Csikszentmihalyi* beziehend, schreibt er:“Yet, although ‚spinning loose’ as it were, the wheel of play reveals to us (as Csikszentmihalyi has argued) the possibility of changing our goals and, therefore, the restructuring of what our culture states to be reality“.
(* Csikszentmihalyi (1975): Mihaly Csikszentmihalyi, Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play, Jossey-Bass, San Francisco, 1975.)
Torrens spricht dem Spiel ein grosses Potential zu, so schreibt er:
„It has no instrumental potency; it is, we might say, a “shadow warrior” […] For this very reason, it’s metacommunication is great; nothing human escapes it. Still in its oxymoronic style it has a dangerous harmlessness, for it has no fear. […] It has the powers of the weak, an infantile audacity in the face of the strong. “
Was mich am Spiel, wie hier beschrieben, besonders fasziniert, ist eben dieser undefinierte Raum, der durch seine Beweglichkeit die Möglichkeit eröffnet fixe Strukturen aufzulösen und die Gefüge neu zusammenzusetzen.
Und so ermöglicht es auch das Entstehen neuer Gesellschaftsordnungen:
„Play can be defined as dangerous as for its capability to subvert the regular alternation between the hemispheres responsible for social order stability“
Das Ganze hat eigentlich recht viel mit meiner künstlerischen Arbeitsweise zu tun. Immer wieder versuche ich mich in eben diesen offenen Zustand „des Spiels“ hineinzuversetzen. Es kann manchmal unangenehm sein, weil man sich eben nirgends festhalten kann und man im Moment auch gar nicht weiss, wohin es führen wird. Ich bin jedoch überzeugt davon, dass eigentlich nur durch das Schaffen solcher beweglicher Räume überhaupt Neues entstehen kann; sei es in der Wissenschaft, in der Kunst, der Kultur allgemein, oder auch in der Politik. Gerade im Bildungssystem, wo solche Räume wahnsinnig wichtig wären, sind sie leider viel zu selten vorzufinden.
Die Tendenz alles,was man gerade macht, immer wieder rechtfertigen und definieren zu müssen, seine „wirtschaftliche“ „Relevanz“ aufzuzeigen, verdrängt diese Räume. In einem System, wo alles klar definiert ist und welches seine starren Grenzen hat (die Situationisten sprachen von einer Gesellschaft des Spektakels), wird das Subtile, Feine und Weiche einfach zusammengequetscht, bis es erstickt, oder ausweicht, wohin auch immer. Der Raum auf der Erde ist begrenzt, der Raum unserer Vorstellung zumindest unendlich mal grösser.
Wenn ich, zum Beispiel, im Zug ein Zelt aufstelle, versuche ich mit diesen fixen Strukturen zu spielen. Wenn der Raum auf der Erde begrenzt ist, so müssen wir innerhalb dieser Grenzen Raum zurückerobern. Diese Rückeroberung kann meiner Ansicht nach schlecht durch Gewalt passieren, die Gegengewalt wäre sowieso tausendmal stärker. Da ist doch das „Spiel“, oder wie immer wir es auch nennen mögen tausendmal praktischer: Wird es verdrängt, geht es einfach wo anders weiter. Es kann sich transferieren von unseren Köpfen raus auf die Strasse, in einen geschriebenen Text, eine Bewegung, ein Bild, ein Computerprogramm,… Da es keine klaren Grenzen hat und seine Regeln offen für Veränderungen sind, kann ihm eigentlich nichts in den Weg gelegt werden, oder wie auch schon Goethe meinte: „aus Steinen, die einem in der Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen“
Vielleicht könnte man diesen Zustand auch Lösung nennen.
(video by Stina Kasser und Lena Eriksson)
In Zug die Bankomaten waschen geht eigentlich auch. Hier hat es viele Bankomaten und sogar Kunst, welche mir das Wasser dazu liefert. Ein bisschen mulmig ist mir schon zu mute. Immerhin lebe ich in einem Land, in dem Verbrechen gegen das Geld höher bestraft werden, als solche gegen den Menschen oder gar das Tier. Aber ich mache ja nichts Verbotenes. Ich wasche bloss Bankomaten, wo sonst das Geld gewaschen wird. Und die Bankomaten sind tatsächlich schmutzig, besonders in den Ecken und Winkeln, da ist der Dreck kaum wegzukriegen. Wie lange wird es wohl dauern, bis jemand von der Sicherheit auftaucht und mich fragt, was ich hier mache?
Der erste Bankomat ist sauber, also wasche ich noch den zweiten. Anscheinend stört es niemanden, was ich mache. Entweder denken sie, ich sei dafür angestellt, oder sie sind sogar froh über meine Arbeit. Wer weiss? Vielleicht bemerkt mich auch einfach niemand – obwohl, beobachtet werde ich schon, aus sicherer Distanz, ausserhalb der Reichweite meiner Kamera. Da steht ein grauhaariger Mann im Anzug. Oder ist das nur Zufall?
Ich gehe zum nächsten Bankomaten, er steht im Innenraum, ist eigentlich recht sauber, aber ich finde auch hier ein wenig Dreck, den ich wegputzen kann.
Der letzte Bankomat in der Bahnhofspassage ist der schmutzigste, der ist richtig eklig. Ich nehme meine Aufgabe sehr ernst und putze auch den, bis er wieder glänzt.
Nun muss ich leider schon wieder weiter. Ich wasche meine Hände. Gründlich.
 ZELTREISE
ZELTREISE